



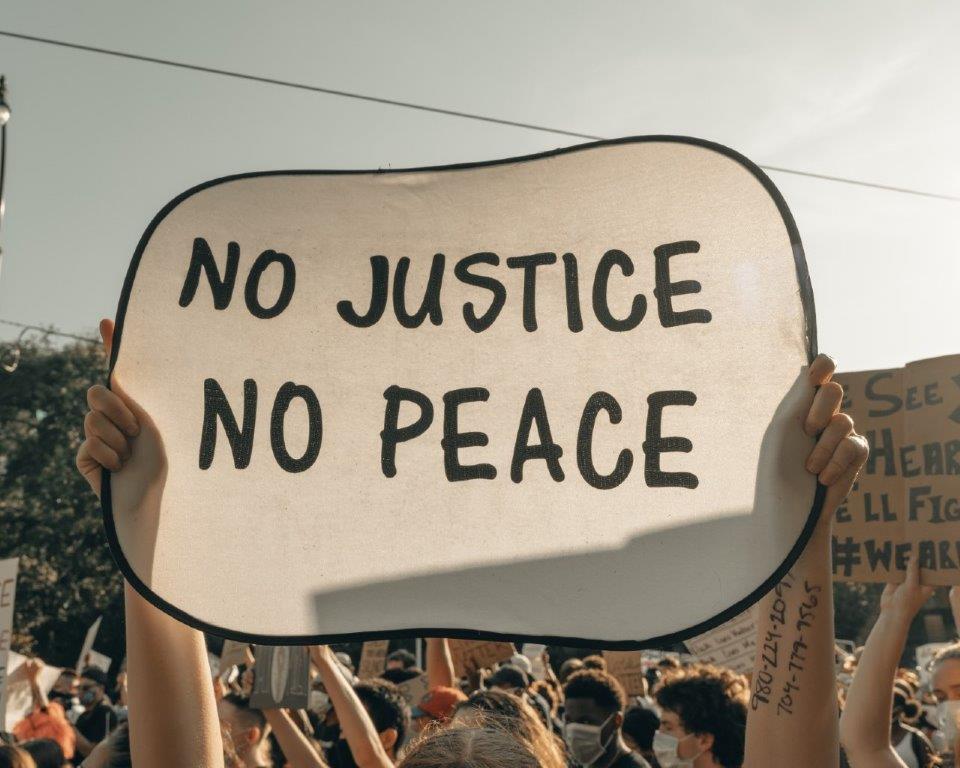











Liebe Interessierte am Forum Ökumene,
liebe Freundinnen und Freunde von Pro Ökumene,
Unser argumentativer Beitrag zur Diskussion über die Erklärung des ÖRK-Zentralausschusses zu Palästina und Israel hat eine erfreuliche Resonanz gefunden. Wir haben zahlreiche Reaktionen erhalten, fast alle sehr wertschätzend,
manche mit konstruktiv-kritischen Rückfragen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
In der Zwischenzeit hat sich vieles ereignet: Weitere deutsche Kirchenvertreterinnen und -vertreter haben sich von der ÖRK-Erklärung distanziert. Zugleich hat sich die humanitäre Katastrophe in Gaza, ebenso die Siedlergewalt
in der Westbank dramatisch zugespitzt. Dabei geht es um mehr als um die Ermöglichung von Hilfslieferungen und um das blanke Überleben von Millionen von Menschen. Die Zukunft der Region steht auf dem Spiel und ebenso unsere Glaubwürdigkeit.
Aus diesen Gründen senden wir Ihnen ein ausführliches Papier, in dem wir die in unserem Brief vom 6. Juli 2025 angesprochenen Gesichtspunkte vertiefen und die an uns gerichteten Rückfragen aufnehmen. Es ist ein Arbeitspapier,
das Argumente und Perspektiven zur Sprache bringt, die im deutschen Kontext oft verengt diskutiert werden. Wir hoffen, damit wiederum einen Beitrag zu einer notwendigen differenzierten Debatte zu leisten.
Wenn gefragt wird, weshalb wir dem Thema Israel-Palästina so viel Raum geben, wo es doch so viele andere Konflikt- und Krisenherde und so viel mehr humanitäre Katastrophen gibt, so möchten wir darauf hinweisen, dass sich der ÖRK zu
all diesen Tragödien zu Wort meldet und zum "Beten und Tun des Gerechten" aufruft. Als Pro Ökumene setzen wir uns mit unseren "Forum Ökumene"-Veranstaltungen mit einer großen Bandbreite an Themen, Herausforderungen und Kontexten auseinander.
Die bedrückende, dramatische Aktualität und die Tatsache, dass deutsche Kirchen sich von der ÖRK-Erklärung distanziert und sich damit auch ökumenisch isoliert haben, veranlasst uns, uns nochmals ausführlicher zu Wort zu melden.
Wir sind wieder dankbar für Rückmeldungen, ob zustimmend oder kritisch.
Auf zwei Veranstaltungen zum Themenbereich möchten wir bereits jetzt hinweisen, beide im Haus der Kath. Kirche in Stuttgart:
- Mittwoch, 24. September 2025, 19.00-20.30 Uhr: "Sehnsucht nach Frieden - eine Stimme aus Palästina" mit Faten Mukarker
- Mittwoch, 26. November 2025, 19.00-20.30 Uhr: "Den Schmerz der Anderen verstehen" mit Charlotte Wiedemann
Mit herzlichen Grüßen im Namen von Pro Ökumene
Bernhard Dinkelaker

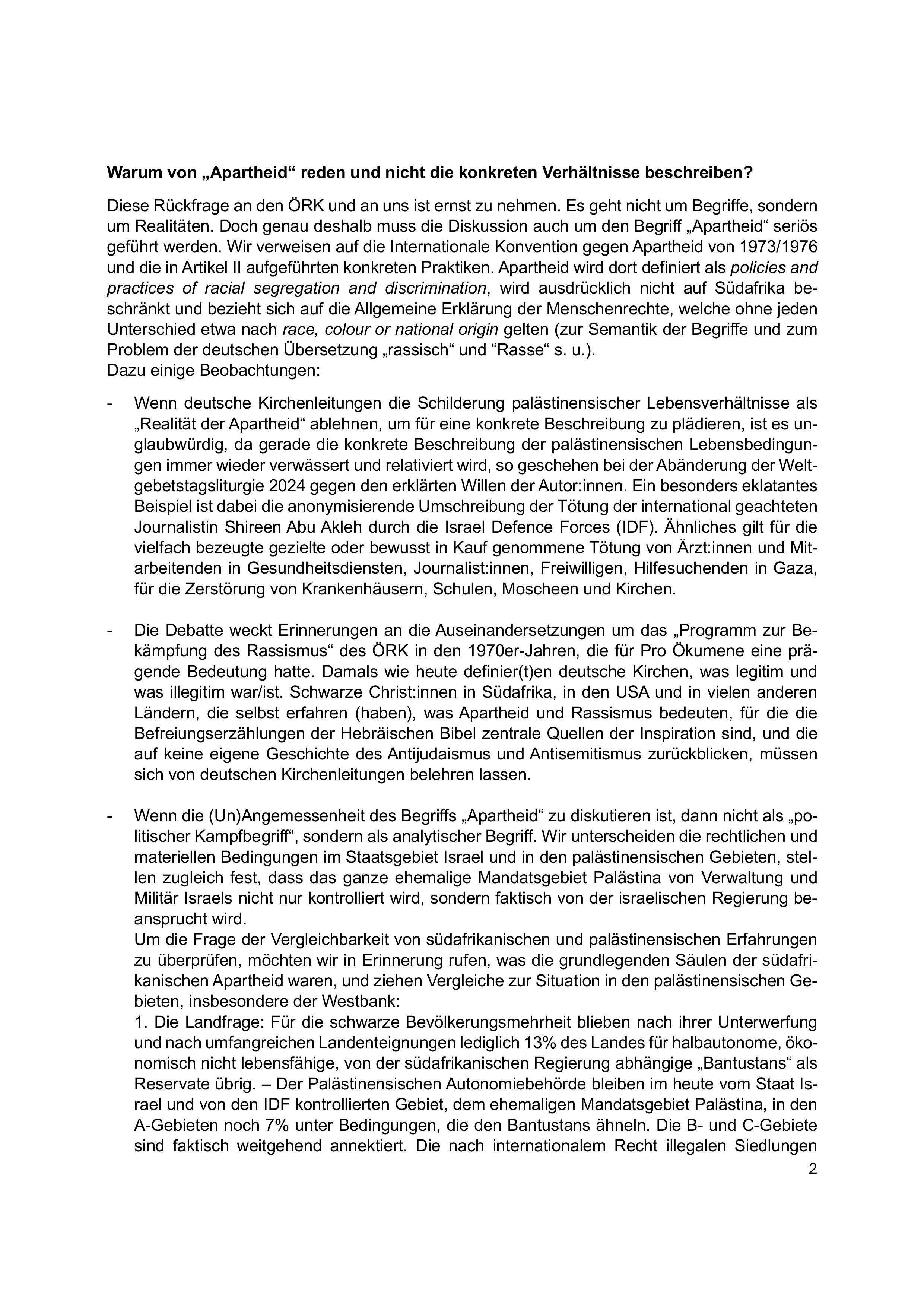

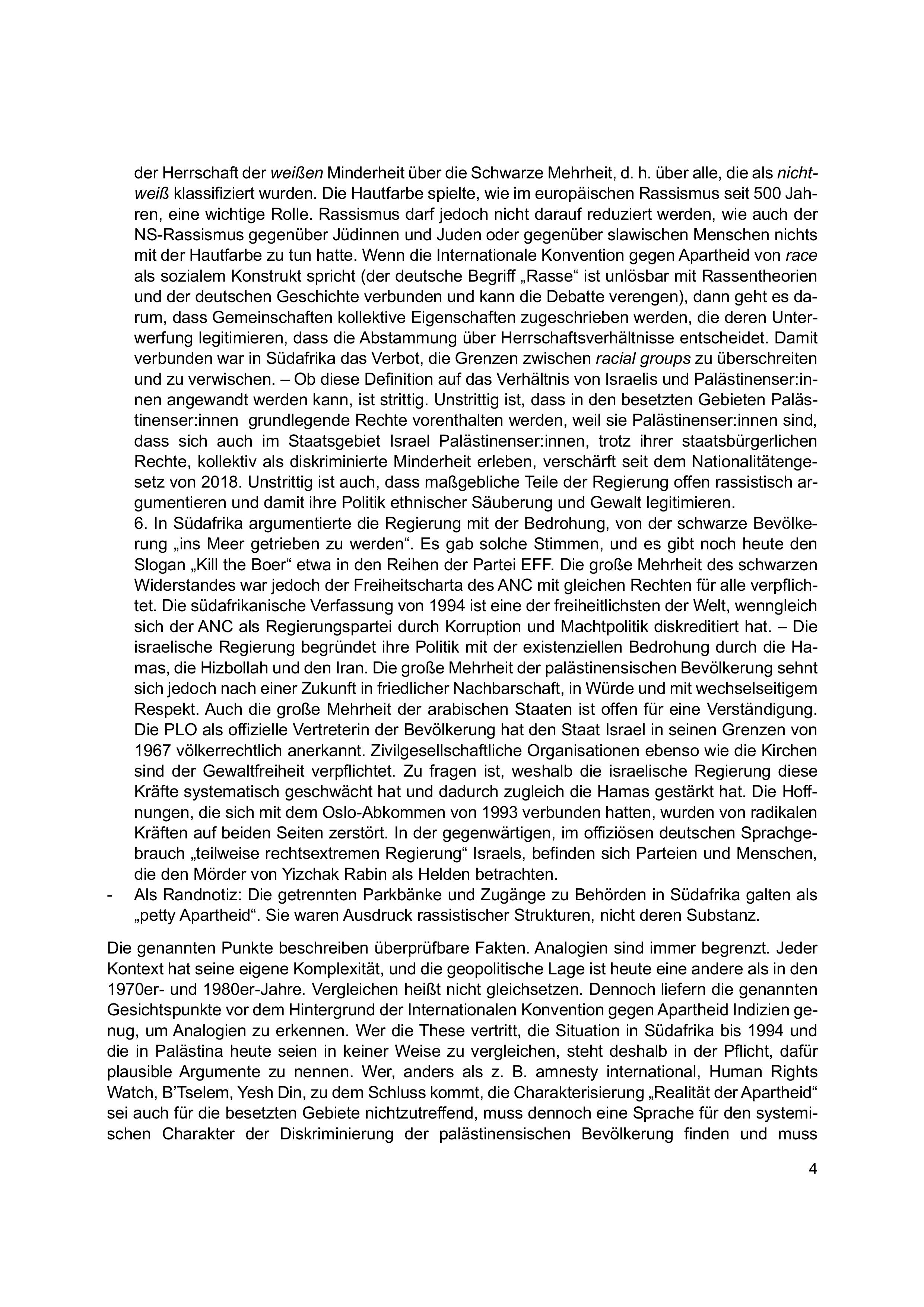

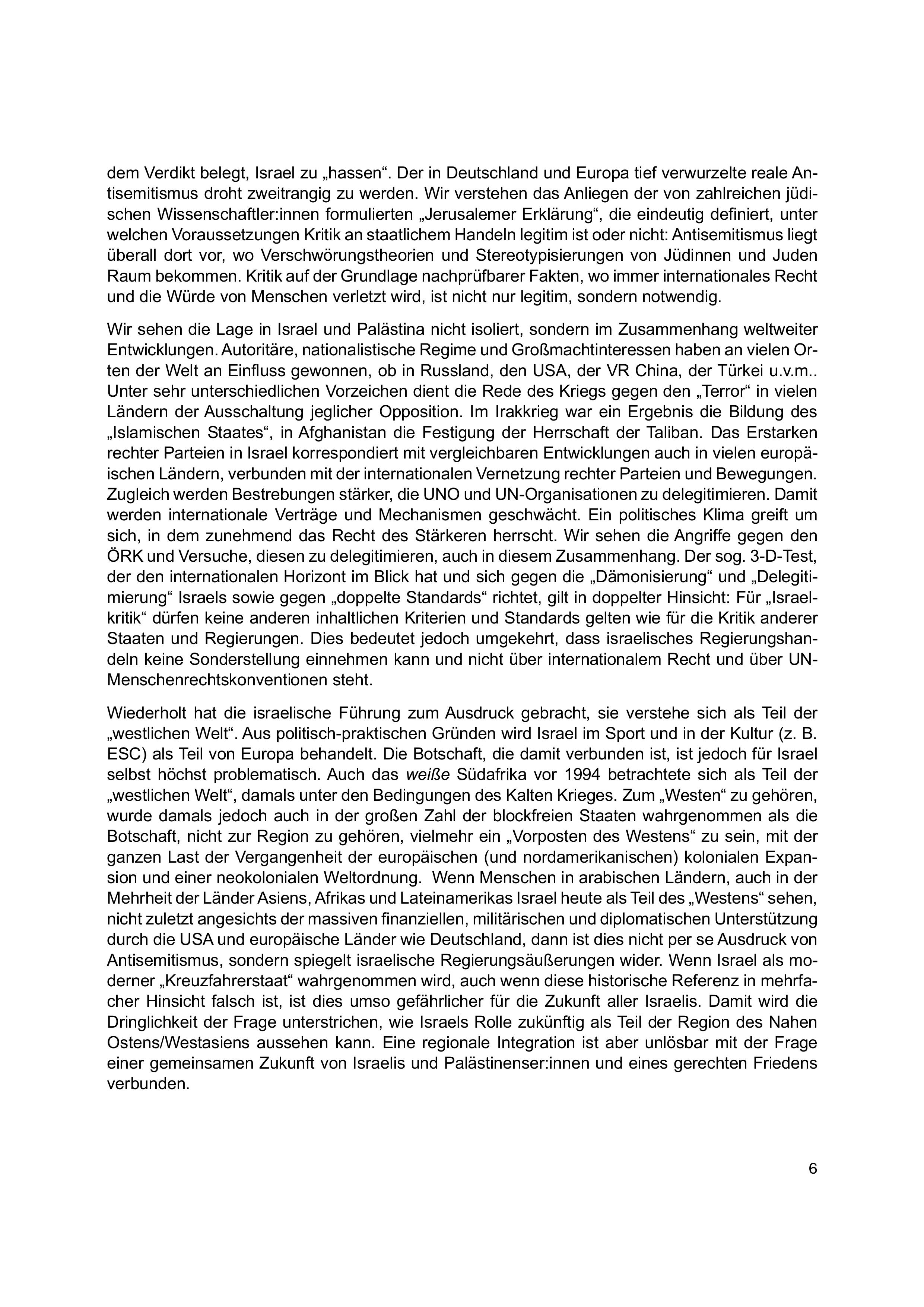


Liebe Interessierte am Forum Ökumene,
liebe Freundinnen und Freunde von Pro Ökumene,
Eine Erklärung des ÖRK-Zentralausschusses zu Palästina und Israel (https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/statement)
und ein kritischer Kommentar von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl haben zu Kontroversen geführt und zu Anfragen an uns als Pro Ökumene, wie wir uns dazu äußern. Landesbischof Gohl stimmt der Erklärung in der Frage von Besatzung und
Straflosigkeit, z. B. von gewalttätigen Siedlern, zu, wirft der ÖRK-Erklärung aber fehlende Empathie mit Jüdinnen und Juden vor und kritisiert insbesondere die Verwendung des Begriffs Apartheid im Hinblick auf Israel als einen
"politischen Kampfbegriff", der "sachlich falsch" sei, da er sich auf den historisch besonderen Kontext Südafrikas vor 1994 beziehe, welcher mit Israel nicht vergleichbar sei. Bereits auf der ÖRK-Vollversammlung 2022 in Karlsruhe
wurde der Begriff Apartheid sehr kontrovers diskutiert mit dem Ergebnis, dass dem ÖRK der Auftrag erteilt worden war, die Angemessenheit oder Unangemessenheit dieses Begriffs zu überprüfen.
Es ist gut, dass die Erklärung des ÖRK-Zentralausschusses wahrgenommen und auch kritisch kommentiert wird. Für eine faire und sachliche Auseinandersetzung dürfen jedoch wesentliche Gesichtspunkte nicht ignoriert werden:
1. Die Erklärung des Zentralausschusses ist eine Erklärung von Delegierten aus allen Kontinenten (unter dem Vorsitz von Heinrich Bedford-Strohm). Der häufig erhobene Vorwurf der Einseitigkeit von Erklärungen der Kirchengemeinschaft
fällt aus der Sicht vieler Kirchen und Menschen, insbesondere aus dem "Globalen Süden", auch aus den USA, auf Deutschland bzw. den sog. Westen zurück, dem umgekehrt doppelte Standards und Unglaubwürdigkeit bescheinigt werden.
Ein Beispiel unter anderen ist die unterschiedliche Bewertung und Kommentierung von Urteilen des Internationalen Strafgerichtshof, wenn es um Kriegsverbrechen in afrikanischen Ländern und in der Ukraine einerseits oder in Israel-Palästina andererseits ging.
2. Die ÖRK-Leitungsgremien haben immer wieder von der Hamas die Freilassung der israelischen Geiseln gefordert, ebenso die Wahrung internationalen Rechts (Völkerrecht und humanitäres Völkerrecht) auf allen Seiten. Sie sind immer
eingetreten für einen gerechten Frieden und für eine gemeinsame Zukunft von Israelis und Palästinensern, von Juden, Christen und Muslimen in Sicherheit und wechselseitigem Respekt, sowie für gewaltfreie Formen der Konfliktbearbeitung..
3. Es waren nicht zuletzt südafrikanische Christen und Christinnen, die in der Begegnung mit der palästinensischen Bevölkerung ihre eigenen Erfahrungen unter der Apartheid wiedererkannt haben. Erzbischof Desmond Tutu sah die
palästinensischen Lebensbedingungen als noch dramatischer an als die in Südafrika unter der Apartheid. Der Begriff "Apartheid", in Südafrika 1948 geprägt, war und ist jedoch nicht auf dieses Land beschränkt. Die Internat.
Konvention gegen Apartheid von 1973, in Kraft gesetzt 1976, auch von der Bundesrepublik Deutschland und 109 anderen Staaten ratifiziert, definiert sie als "unmenschliche Handlungen, die zu dem Zweck begangen werden, die Herrschaft
einer rassischen (Englisch: racial) Gruppe über eine andere rassische Gruppe zu errichten und aufrechtzuerhalten und diese systematisch zu unterdrücken", ganz gleich an welchem Ort der Erde und ausdrücklich nicht nur in Südafrika.
4. Die ÖRK-Erklärung zu Israel-Palästina spricht von der "Realität der Apartheid", nicht von einem "Apartheidstaat". Wenn diskutiert wird, ob diese Beschreibung unangemessen ist oder nicht, ist zu differenzieren: Bezogen auf das
Staatsgebiet Israel in den international anerkannten Grenzen ist der Begriff "Apartheid" problematisch, wenngleich sich die palästinensische Minderheit als diskriminiert erfährt, verschärft durch das Nationalitätengesetz von 2018.
In den besetzten Gebieten dagegen, d. h. Westbank und Gaza, treffen alle in Artikel II der Internat. Konvention gegen Apartheid genannten Praktiken ohne Zweifel zu. Diskussionswürdig ist allenfalls die Frage, ob es sich um "rassische (racial)"
oder um "ethnonationale" Diskriminierung handelt.
5. Die "in Teilen rechtsextreme Regierung" Israels schließt eine Zweistaatenlösung kategorisch aus und vertritt die Position eines Staates Israels "from the river to the sea". Dies bedeutet faktisch die fortschreitende Annexion palästinensischer
Gebiete (Siedlungen und militärische Gebiete, exklusives Straßennetz, israel. Militär- und zunehmend Zivilverwaltung). Maßgebliche Mitglieder der Regierung vertreten offen und unverblümt rassistische Überzeugungen und setzen diese ohne Skrupel um,
meist mit Unterstützung der israelischen Sicherheitskräfte. Das Konzept eines solchen Staates beruht auf dem Ausschluss elementarer Existenzrechte der palästinensischen Bevölkerung. In diesem Zusammenhang ist die Bezeichnung "Apartheid" nicht unangemessen.
6. Damit werden weder die Kriegsverbrechen der Hamas verharmlost noch wird der Staat Israel dämonisiert. Die Anwendung des 3-D-Tests (keine Dämonisierung, keine Delegitimierung und keine doppelten Standards) beinhaltet im Umkehrschluss, dass auch für den
Staat Israel dieselben Regeln gelten müssen wie für alle anderen Staaten. Diese Position wird auch von vielen jüdischen Wissenschaftler:innen, Journalist:innen und Friedensaktivist:innen vetreten.
7. Die ÖRK-Leitungsgremien äußern sich ebenso zu den vielen anderen Tragödien in der Welt, ob im Sudan, in Myanmar, in Syrien, in der Ukraine und anderswo, überall dort, wo die verwundbarsten Menschen am meisten leiden.
Wir hoffen, mit diesen Gesichtspunkten einen sachlichen Beitrag zur notwendigen Diskussion zu leisten.

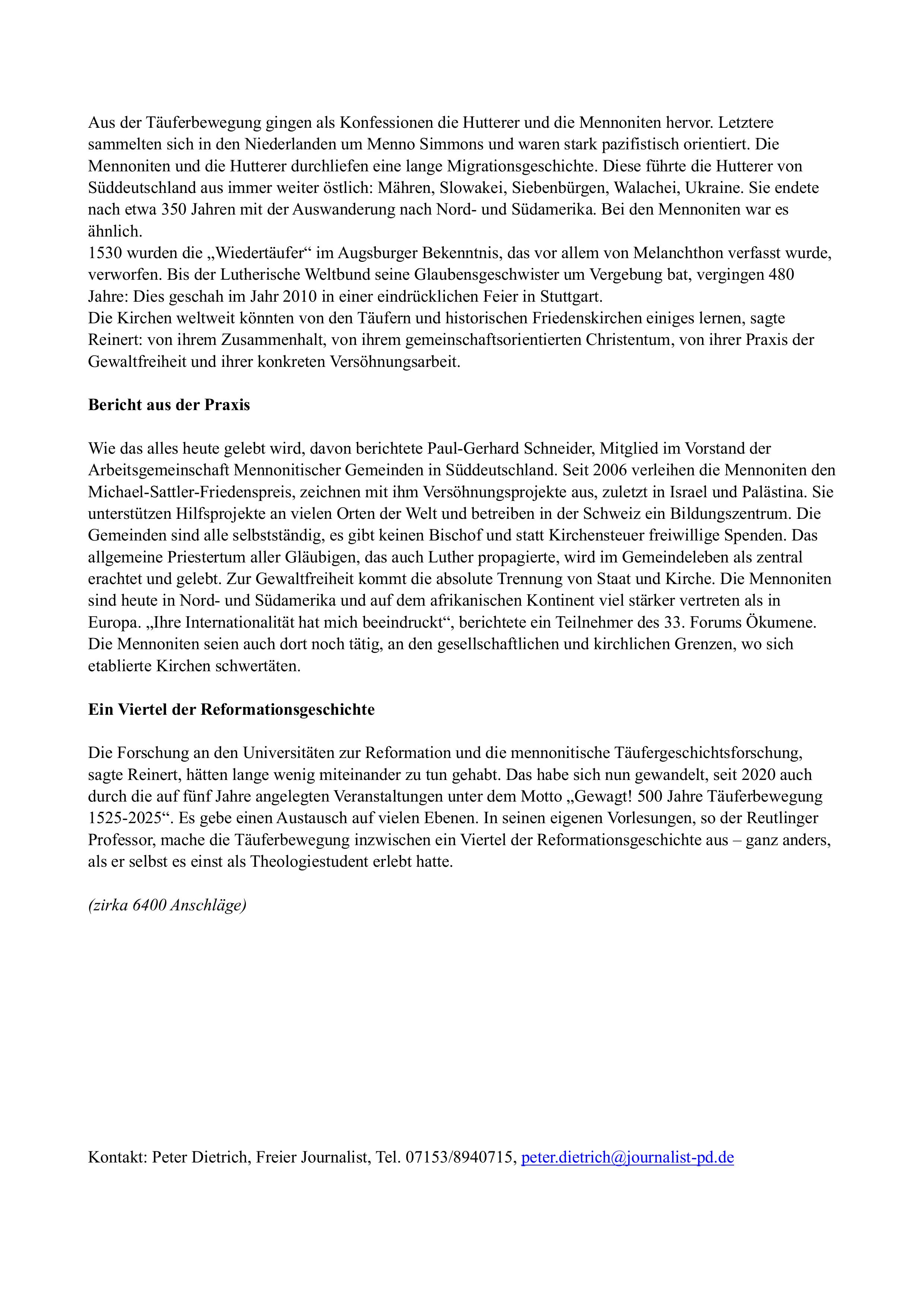
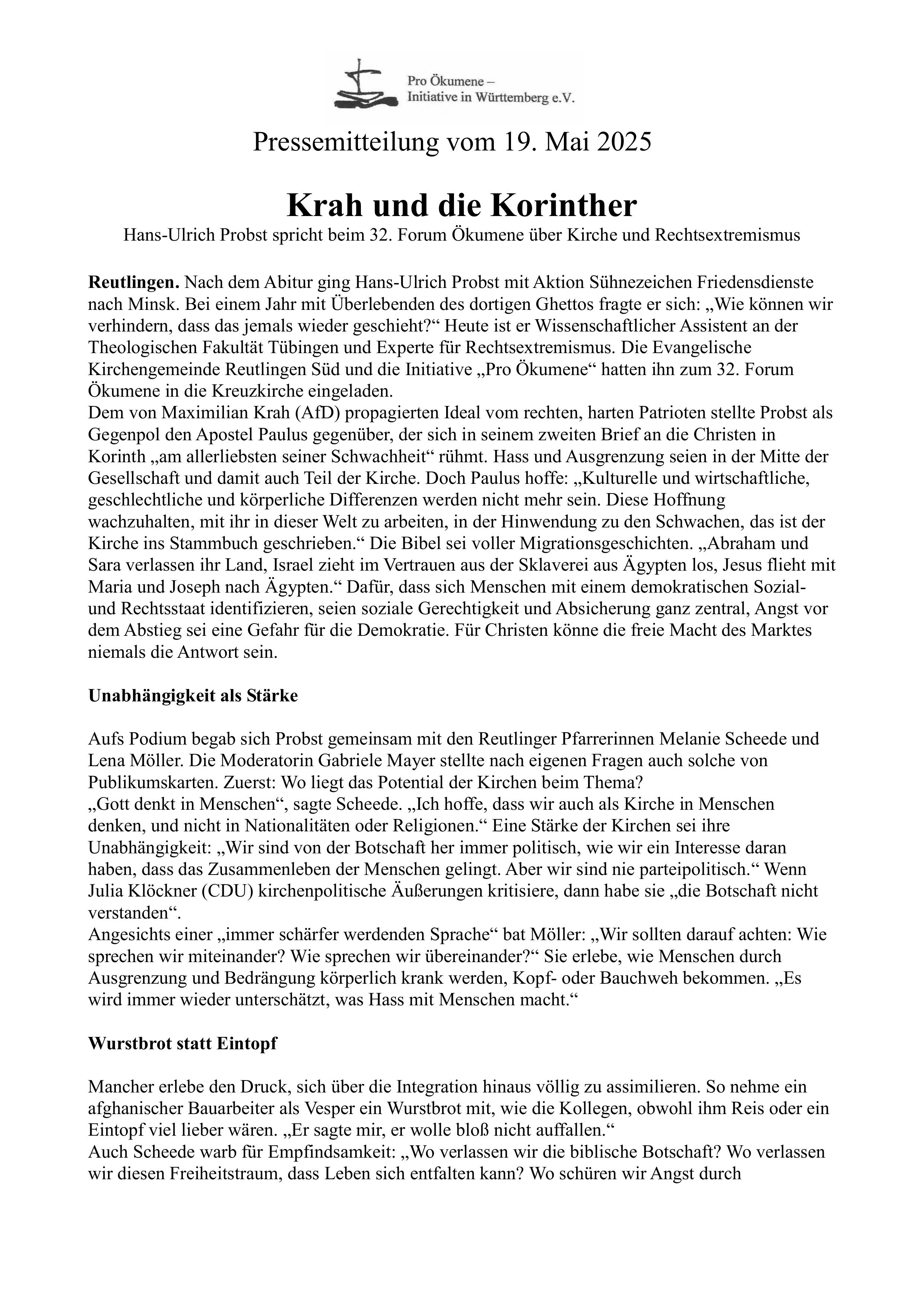


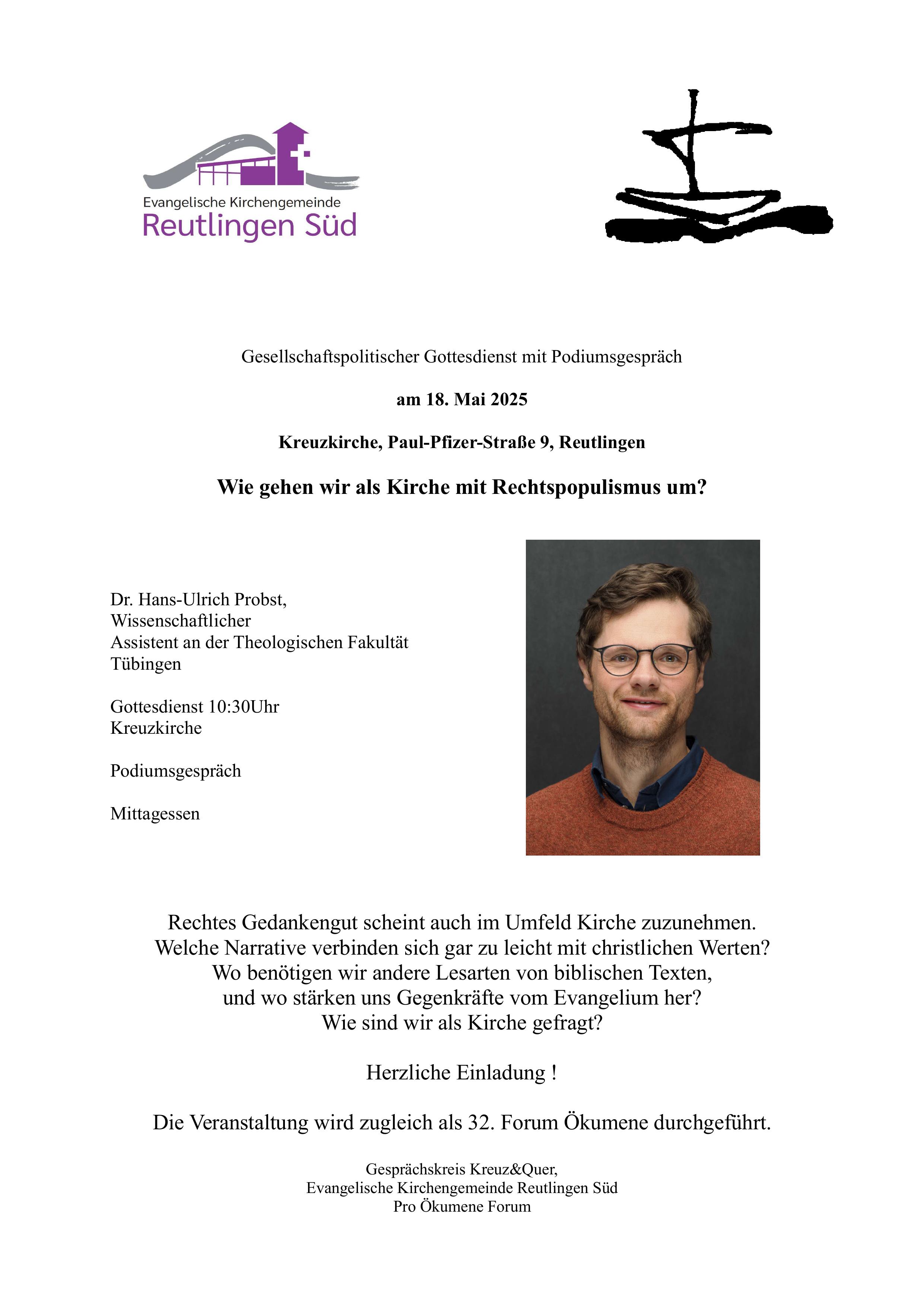


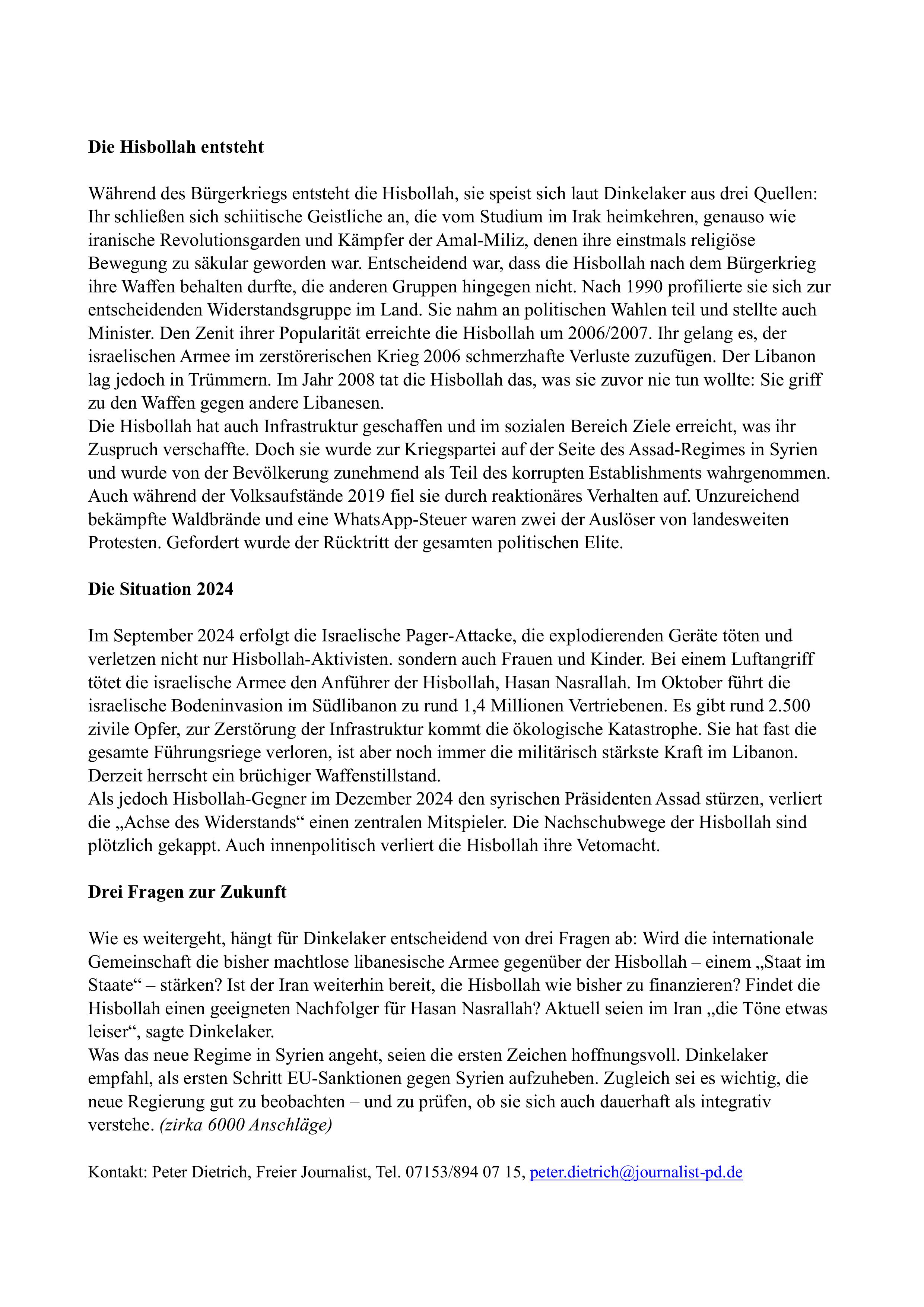

In den 1970er-Jahren wurde der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) wegen seines „Programms zur Bekämpfung des Rassismus“ heftig angegriffen. Weite Teile der württembergischen Landessynode forderten den Austritt der Landeskirche aus dem ÖRK. Deshalb fanden sich engagierte württembergische Christinnen und Christen 1975 zusammen und gründeten „Pro Ökumene – Initiative in Württemberg e. V.“, um ein sichtbares Zeichen für die ökumenische Gemeinschaft zu setzen.
In den ersten Jahren stand die Solidarität im Kampf um die Überwindung von Apartheid und Rassismus im Vordergrund. „Pro Ökumene“ setzte sich aber allgemein das Ziel, über die Arbeit des ÖRK zu informieren und Themen aus der weltweiten Ökumene zur Sprache zu bringen: Eintreten für weltweite Gerechtigkeit, für einen gerechten Frieden, für die Bewahrung der Schöpfung und Klimagerechtigkeit, für eine Mission und für interreligiöse Beziehungen im Dienst des Lebens, für ökumenisches und interkulturelles Lernen. Dies geschieht durch Veranstaltungen und Publikationen wie dem „Pro Ökumene-Informationsdienst“ und Pressemitteilungen. 50 Prozent des Spendenaufkommens von Pro Ökumene werden dem ÖRK zur Verfügung gestellt, insbesondere für Programme mit jungen Menschen.
Aus der Arbeit von Pro Ökumene sind mehrere ökumenische Initiativen hervorgegangen, die selbstständig operieren, so die Initiative „Ohne Rüstung leben“ ( https://www.ohne-ruestung-leben.de/aktuell.html) und die „Stiftung Ökumene“ (https://www.ecunet.de/).
Seit 2016 führt „Pro Ökumene“ gemeinsam mit dem Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung (DiMOE), der Evang. Mission in Solidarität (EMS) und anderen Kooperationspartnern die Veranstaltungsreihe „Forum Ökumene“ durch. Drei bis vier Gesprächsabende zu aktuellen Themen pro Jahr dienen der Vernetzung mit ökumenisch interessierten Menschen und stellen eine kritisch-solidarische Öffentlichkeit her.
Zur Zeit der Gründung von „Pro Ökumene“ wurde das öffentliche, gesellschaftliche Zeugnis von Christ:innen vielfach grundsätzlich in Frage gestellt. Viele damals umstrittene Themen sind heute im Leben unserer Kirche verankert, in Gemeinden, in lokalen Initiativen, in Partnerschaften, vielfach jedoch an Fachstellen delegiert. Der weltweite Horizont rückt in Zeiten abnehmender Mittel und Mitgliederzahlen ferner. „Pro Ökumene“ hält das Bewusstsein wach, dass wir nur als Teil der „Oikoumene“, des weltweiten Leibes Christi und des ganzen bewohnten Erdkreises, wirklich Kirche sind. „Pro Ökumene“ schafft Räume, in denen Stimmen hörbar werden, die oft an den Rand gedrängt und zum Schweigen gebracht werden.
Ökumenische Vernetzung Casa Común 2022 Martin Gück, Koordinator Fon: +49 6221 800255 | Mobil: +49 176 54471059 E-mail: info@casa-comun-2022.de | www.casa-comun-2022.de
Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) Ecumenical Centre, 1 Route des Morillons 1218 Le Grand-Saconnex Switzerland https://www.oikoumene.org/de
Ohne Rüstung Leben e. V. Arndtstraße 31 70197 Stuttgart Telefon 0711 608396 Telefax 0711 608357 https://www.ohne-ruestung-leben.de/impressum.html
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg DiMOE Geschäftsstelle Büchsenstr. 33 70174 Stuttgart 0711-229363-270 https://www.dimoe.de/
Evangelische Mission in Solidarität (EMS) Vogelsangstr. 62 D-70197 Stuttgart Tel.: +49 711-636 78 -0 E-Mail: info@ems-online.org | www.elk-wue.de/ems
1. Vorsitzende Heike Bosien 2. Vorsitzender Reinhard Hauff 3. Vorsitzende Catherine Nzimbu Mpanu-Mpanu-Plato
E-Mail: pro.oekumene@gmail.com